eigenarten
eigenarten
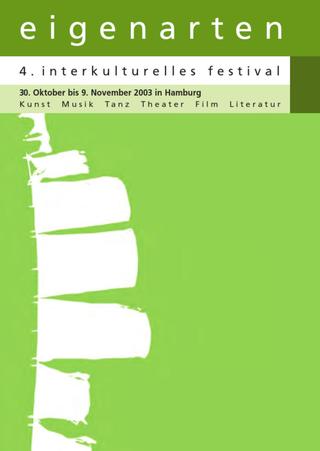
2000 bis 2019 hat das Interkulturelle Festival jeweils im Herbst in Hamburg lebende Künstlerinnen und Künstler aus aller Welt zusammengebracht, die Musik-, Theater-, Tanz-, Fotografie- und Filmproduktionen erarbeiteten. Es wurden durchschnittlich elf Festivaltage durchgeführt, in den zwanzig Jahren wirkten rund 640 interkulturell zusammengesetzte Künstlergruppen mit, pro Festiv Von al konnten zwischen 30 und 45 Produktionen gezeigt werden, insgesamt präsentierte man mehr als 750 Veranstaltungen, davon waren 260 Premieren. eigenarten bespielte im ganzen Stadtgebiet rund 100 Kleine Bühnen, Große Häuser, Soziokulturelle Zentren, Bibliotheken und Öffentliche Räume. Über 80.000 Besucherinnen und Besucher haben an den Veranstaltungen teilgenommen.
Angesichts der 20-jährigen Geschichte des Festivals in Hamburg haben Angela Grotheer und ich den Auftrag zur Evaluierung von eigenarten übernommen. Wir hatten das Festival von Anfang an in allen zwanzig Jahren besucht bzw. begleitet und konnten aufgrund von persönlichen Kontakten zur Festivalleitung hinter die Kulissen schauen. Wir fanden eigenarten immer sehr gut und wichtig, sind aber nie unkritisch gewesen – ganz im Gegenteil.
Das Interkulturelle Kunstfestival Hamburg war eines der ersten seiner Art in Deutschland. Mit einem solchen Vorhaben wird ein öffentliches Diskursfeld geschaffen, in dem die gesellschaftlichen Grenzziehungen zwischen „Etablierten“ und „Außenseitern“, „Eigenem“ und „Fremdem“ oder „Wir“ und „die Anderen“ markiert, ausgehandelt oder verschoben werden. Minoritätenkunst entsteht oftmals in der Reflexion und Erinnerung, Verdichtung und Objektivierung persönlicher und/oder kollektiver Erfahrungen der Kunstschaffenden als Teil einer wenig anerkannten Minderheit. Dies führt zugleich zur Frage nach den Arbeitsbedingungen im künstlerischen Feld der Interkultur. Nischenkunst ist regelhaft prekär finanziert, in machtvolle Strukturen eingebettet und in die gesellschaftlichen Kämpfe sozialer Gruppen um Anerkennung und Partizipation verstrickt. Wie also können interkulturell arbeitende Kunstschaffende in den Kunststätten des Bildungsbürgertums ihr Recht auf eigene Themen und faire Produktionsbedingungen behaupten? Welchen Stellenwert hat „Interkultur“ in der Kulturpolitik? Wer fördert Interkulturelle Kunst, und warum?
Am Beispiel des Interkulturellen Festivals in Hamburg konnten wir folglich die Wirkungen interkultureller Öffnungsprozesse in der Kunst und insbesondere in den Veranstaltungsstätten untersuchen. Können die Versäulungen zwischen Hochkultur und Off-Kunst, zwischen Mainstream- und Alternativkunst aufgebrochen werden? Wo genau liegen die Interessen einzelner Zielgruppen und sozialer Milieus? Welche Kooperationsmöglichkeiten zwischen den kulturell engagierten Migrationsinitiativen und den „weißen“ Kulturinstitutionen gibt es? Können sich die Künstlerinnen und Künstler durch die Teilnahme an solchen Festivals jenes Wissen und die erforderlichen Kompetenzen aneignen, um erfolgreich im Kultumanagement zu agieren und in die kulturellen Praxisfelder der Majorität vorzudringen? Lassen sich daraus Qualitätsmerkmale für das künstlerische Praxisformat „Festival“ gewinnen?
Veröffentlichung zu eigenarten
- eigenarten. Dem kulturellen Reichtum auf der Spur. Interkulturelles Festival Hamburg. Erfahrungen, Ergebnisse, Empfehlungen. (Zusammen mit Angela Grotheer). Hamburg: Argument Verlag 2020.